
Aristoteles: Politiká
Platon war bereits 60 Jahre alt und sollte bald darauf zum zweiten Mal nach Sizilien reisen, als ein 17-Jähriger aus Makedonien, einem bis dahin völlig unbedeutenden Landstrich ganz im Norden Griechenlands, um Aufnahme in seine Akademie bat. Der Junge stammte aus gutem Hause, hatte doch der verstorbene Vater des Jungen als Leibarzt dem dortigen König gedient. Wie sich zeigen sollte, war die Aufnahme völlig berechtigt, denn der Neuling lernte schnell und war bald schon ein respektiertes Mitglied, das schließlich selbst eine Lehrtätigkeit in der Akademie ausübte. So gingen beinahe zwanzig Jahre eines wohlgeordneten Gelehrtenlebens dahin. Doch dabei sollte es nicht bleiben.
Denn währenddessen war in der Heimat Philipp II. an die Macht gelangt, unter dem Makedonien schnell an Einfluss gewann und der bald die gesamte Nordküste der Ägäis unterworfen hatte. Innerhalb weniger Jahre wuchs sein Erorberungsdrang zu einer solchen Bedrohung für alle griechischen Städte heran, dass das allgemeine Misstrauen auch vor dem makedonischen Akademie-Mitglied nicht Halt machte. Im Jahr 347 vor Christus starb Platon und mit ihm ein wichtiger Fürsprecher des eingewanderten Philosophen, der daraufhin sicherheitshalber in Richtung Kleinasien abreiste.
Dort erreichte ihn vier Jahre später ein Angebot von eben jenem Mann, dessen Eroberungszüge seinen Verbleib in Athen unmöglich gemacht und der dabei zudem seine Heimatstadt Stageira zerstört hatte: Philipp II. lud ihn nun dazu ein, seinen Sohn zu unterrichten. Der Stagirit ließ sich darauf ein und so wurde Aristoteles für drei Jahre Lehrer des 14-jährigen Thronfolgers Alexander. Neben Philosophie umfasste die Unterweisung Naturwissenschaften, Medizin, Geographie, Literatur und Mythologie. Letztere war eigentlich kein typisch makedonischer Lehrinhalt, aber dafür unverzichtbarer Bestandteil griechischer Bildung. Dieser wurde dem jungen Königssohn offenbar so überzeugend nahegebracht, dass er sein Leben lang ein von seinem Lehrer kommentiertes Exemplar von Homers großer griechischen Sage Ilias bei sich getragen und ihrem Helden Achilles nachgeeifert haben soll.
Als König unterwarf Alexander ganz Griechenland, den großen Rivalen Persien, Ägypten und erreichte die Grenzen Indiens. Der makedonische König war zweifellos ein herausragender Feldherr, doch er war auch von bestialischer Grausamkeit: Er ließ nicht nur seinen eigenen Vater ermorden, die Bevölkerung von mehreren Städten auslöschen, große Teile seines Heeres in einer Wüste umkommen, sondern bei einem Gelage tötete er in betrunkenem Zustand auch einen langjährigen Freund wegen ein paar Unmutsäußerungen, obwohl dieser ihm zuvor in der Schlacht am Granikos das Leben gerettet hatte. Alexander der Große war ein Mann des Krieges, dem für einen geeigneten Herrscher im Sinne Platons zweifelsohne zwei Eigenschaften fehlten: Besonnenheit und Gerechtigkeit. Das also war das Ergebnis jener in der Weltgeschichte einmaligen Konstellation, in der ein großer Philosoph einen künftigen großen Herrscher unterrichtet hatte: Die alte Weltordnung war zerstört und ein Makedone eroberte den Orient. Obwohl Alexander nur 32 Jahre alt wurde und das Reich sogleich wieder zerfiel, hinterließ er in allen eroberten Gebieten Spuren der hellenischen Kultur.
nach dem Ausgleich oder dem höchsten streben?
So einzigartig und faszinierend das Arrangement, so wenig greifbar sind die gegenseitigen Wirkungen dieser Verbindung. Aristoteles mag Alexanders Geist geschärft und ihm Vorbilder aus der griechischen Mythologie nahe gebracht haben. Kaum vorstellbar ist hingegen, dass die Kühnheit des Eroberers vom Philosophie-Unterricht herrührte, denn sein Lehrer war von völlig anderer Wesensart. Aristoteles kannte keine Extreme, sondern suchte stets den Ausgleich. Das Streben zur Mitte erklärte er zur Tugend. Während der makedonische König sich anschickte, den gesamten Nahen Osten umzukrempeln, propagierte der stageirische Philosoph Eigenschaften wie Bescheidenheit, Zuverlässigkeit und Angemessenheit. Aber mit solchen Tugenden ließe sich freilich kein Weltreich erobern, vielmehr liest sich dieses philosophische Programm eher wie der Gegenentwurf expansionistischer Kriegsführung.
„Wahr aber bleibt, daß die größten Ungerechtigkeiten von denen ausgehen, die das Übermaß verfolgen, nicht von denen, die die Not treibt.“ (Aristoteles 1995b, S. 52; 1267a)
Alexander verfolgte zweifellos das Übermaß und ihn trieb keinesfalls die Not. Aristoteles‘ Credo der Ausgewogenheit klingt wie ein Ruf nach Stabilität angesichts des ebenso erfolg- wie folgenreichen Eroberungszugs Alexanders. Dieses Verlangen geht sogar so weit, dass eine Störung der bestehenden Verhältnisse als unrechtmäßig angesehen wird:
„Denn das Proportionale ist die Mitte, und das Gerechte ist das Proportionale. (…) Das Recht ist also dieses Proportionale, das Unrecht aber ist, was wider die Proportionalität anläuft.“ (Aristoteles 1995a, S. 108)
Ungeachtet dessen änderte Alexander Proportionen, verschob die Machtverhältnisse und erkannte keine Grenzen an. Die Bewältigung des scheinbar Unerreichbaren, die Sehnsucht, das menschlich Angemessene hinter sich zu lassen und sich den Halbgöttern der griechischen Sagenwelt nahe zu fühlen, bildeten seinen Antrieb. Recht, Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit interessierten ihn nicht. Es ist nicht auszumachen, ob Aristoteles trotz oder gerade wegen der handstreichartigen Hellenisierung des Vorderen Orients durch seinen eigenen Schüler für die Wahrung des Gleichgewichts eintritt. Jedenfalls ist die Abwesenheit von Alexanders Eroberungszug in der politischen Philosophie des großen Denkers so auffallend, dass Russell sogar vermutet, Aristoteles habe die großen Veränderungen gar nicht in ihrem ganzen Ausmaß erfasst:
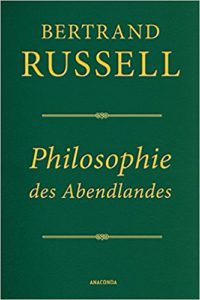
Betrand Russell: Philosophie des Abendlandes
„Viel überraschender ist hingegen, daß Alexander so geringen Einfluß auf Aristoteles ausgeübt hat, der bei seinen politischen Spekulationen einfach nicht bemerkt hatte, wie die Ära der Stadtstaaten von der Ära der großen Reiche abgelöst wurde. Ich fürchte, Aristoteles hat ihn letzten Endes nur für einen ‚faulen, starrköpfigen Jungen ohne jedes Verständnis für Philosophie‘ gehalten. Alles in allem scheint die Begegnung dieser beiden großen Männer so wenig Früchte getragen zu haben, als hätten sie in verschiedenen Welten gelebt.“ (Russell 2009, S. 182)
Da die Entstehungszeit der aristotelischen Schriften nicht geklärt ist, kann man nicht ausschließen, dass die überlieferten Werke zu früh entstanden, um die unumkehrbaren Veränderungen in ihrer vollen Tragweite zu erfassen. Aristoteles war bereits 46 Jahre alt als Philipp II. und sein Sohn in Chaironeira das Ende der griechischen Stadtstaaten besiegelten. Das Erstarken Makedoniens trat allerdings auch schon zuvor unübersehbar zutage und auch die Römer vergrößerten ihr Territorium Schritt für Schritt und bedrohten die griechischen Städte Italiens. Während sich also die Welt um ihn herum wandelte, hielt Aristoteles an der Polis als Hort der Stabilität unverändert fest. Unklar bleibt, ob er die Veränderungen noch nicht zu bewerten vermochte, sie unterschätzte oder aber gerade auf die damit einhergehende Verunsicherung reagierte. Jedenfalls verortete er im griechischen Stadtstaat weiterhin den Garanten der bestehenden Verhältnisse und moralischer Integrität.
„Die Gerechtigkeit aber, der Inbegriff aller Moralität, ist ein staatliches Ding. Denn das Recht ist nichts anderes als die in der staatlichen Gemeinschaft herrschende Ordnung, und eben dieses Recht ist es auch, das über das Gerechte entscheidet.“ (Aristoteles 1995b, S. 5f; 1253a)
Hier erfolgt letztlich gleich eine ganze Kette von Gleichsetzungen: Moralität wird mit Gerechtigkeit, Gerechtigkeit mit Recht, Recht mit Staat, Staat mit herrschender Ordnung und damit schließlich Moralität mit herrschender Ordnung in eins gesetzt. Die bestehenden Verhältnisse werden damit zur maßgeblichen moralischen Instanz erhoben, nach deren Proportionen sich alles zu richten hat. Raum für Veränderungen lässt eine solche Gleichsetzung nicht und genau das dürfte später auch mit ein Grund für die jahrhundertelange Popularität von Aristoteles‘ politischer Philosophie gewesen sein. Liegt Stabilität doch stets im Interesse derjenigen, die durch die Änderung des Gesellschaftsgefüges etwas zu verlieren hätten, also der Mächtigen. Ein Hinweis auf Aristoteles bot da eine willkommene Rechtfertigung, zumal wenn dieser bestehendes Recht – ungeachtet welchen Inhalts – und Gerechtigkeit gleichsetzt, sodass jede Änderung der Gesellschaftsordnung zwangsläufig als ungerecht gebrandmarkt wird.
Wie schon Platon stellt sein Schüler drei guten ebenso viele schlechte Formen gegenüber. Die guten sind Königtum, Aristokratie und Politie. Die „Ausartungen“ (ebd. S. 91; 1279b) davon heißen Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. Die beiden letzten Formen nehmen Staaten laut Aristoteles zumeist deshalb an, „weil nämlich der Mittelstand in ihnen oft wenig zahlreich ist“ (ebd. S. 148; 1296a) und dadurch entweder im Falle der Oligarchie die Reichen oder im Falle der Demokratie die Armen die Macht an sich reißen können. Das Wohl der Gesamtheit leide in beiden Fällen, weil die überlegene Seite nur ihren Nutzen verfolge, das führe aber zu Aufruhr und verhindere Stabilität. Die Reichen seien nicht gewohnt zu gehorchen und die Armen zu unterwürfig, weshalb der Staat möglichst aus Freien und Gleichen bestehen solle. Wo die Mittelschicht am meisten Berücksichtigung finde, dort liege dann die beste Staatsform vor und das wäre die Politie als Mischung aus Oligarchie und Demokratie. Wie dieses Ziel zu erreichen ist und wie man sich das genau vorzustellen hat, dafür fehlen genauere Hinweise. Wichtiger scheint Aristoteles ohnehin ein anderer Punkt zu sein: Die Demokratie, wie er sie in Athen kennengelernt hat, brachte immer wieder ungezügelte Schwankungen des Volkswillens mit sich. Diesem menschlichen Wankelmut misstraute Aristoteles ebenso wie sein Lehrer. Anders als dieser trat er aber nicht für die Philosophenherrschaft, sondern für die stabilisierende Kraft von Gesetzen ein:
„Wer also verlangt, daß die Vernunft herrsche, der scheint zu verlangen, daß Gott und die Gesetze herrschen; wer aber den Menschen zum Herrscher haben will, fügt das Tier hinzu. Denn die Lüsternheit ist etwas Tierisches, und der Zorn setzt auch die besten Männer unter den Regenten in Vewirrung. Daher ist das Gesetz die reine, begierdelose Vernunft.“ (ebd. S. 116; 1287a)
Richtete sich das gegen Alexanders unstillbaren Eroberungsdurst oder gegen die zügellose Demokratie in Athen? Oder gegen beide? Jedenfalls spricht daraus der Wunsch nach Zähmung menschlicher Begierden.

Hubertus Niedermaier: Wozu Demokratie?
Mehr in:
Hubertus Niedermaier:
Wozu Demokratie?
Politische Philosophie im Spiegel ihrer Zeit.
Konstanz und München: UVK 2017.
Aristoteles (1995a): Philosophische Schriften in sechs Bänden, Band 3: Nikomachische Ethik. Hamburg.
Aristoteles (1995b): Philosophische Schriften in sechs Bänden, Band 4: Politik. Hamburg.
Russell, Bertrand (2009): Philosophie des Abendlandes. München.
